
Diskriminierung von Menschen osteuropäischer Herkunft auf dem Arbeitsmarkt: Institutionelle and individuelle Kontexte
Benachteiligungen von Menschen osteuropäischer Herkunft stehen eher selten im Blickfeld der breiteren Öffentlichkeit. Dabei stellen diese mit rund 9, 5 Millionen Menschen die größte Migrationsgruppe der Bundesrepublik und rund ein Neuntel der Gesamtbevölkerung. Ihr Alltag ist oftmals von gesellschaftlichen Barrieren gekennzeichnet, zu denen bisher jedoch wenig fundiertes Wissen vorhanden ist.
Mit unserem Forschungsprojekt tragen wir dazu bei, diese Wissenslücke ein Stück weit zu schließen: Wir konzentrieren uns auf das Zusammenspiel zwischen Arbeitsmarkt und Wohlfahrtsstaat. Insbesondere richten wir unseren Blick auf Arbeitsprozesse, die in Ämtern und Behörden, wie den Jobcentern, stattfinden. Unsere Studie zielt darauf, ein tieferes Verständnis für die entwickelten Strategien und Konzepte zu gewinnen. Dabei nimmt die Perspektive der betroffenen Menschen einen zentralen Stellenwert ein. Vor allem drei Migrationskohorten stehen dabei im Fokus: die sogenannten (Spät-)Aussiedelung des späten 20 Jhd., Arbeitsmigration nach der EU-Osterweiterung 2004/2007/2013 und die Flucht aus der Ukraine seit 2022.
Das Projekt wurde von Dr. Aleksandra Lewicki (University of Sussex), apl. Prof. Dr. Jannis Panagiotidis (RECET Wien) und PD Dr. Hans-Christian Petersen (BKGE Oldenburg) entwickelt und gemeinsam mit dem Postdoc Jure Leko durchgeführt.
Förderung: Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Die Abschlusskonferenz wurde am 26./27. September 2024 gemeinsam von der von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und dem BGKE Oldenburg gemeinsam mit RECET Wien und dem Sussex European Institute ausgerichtet. Das Programm finden Sie hier.
Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und die Aufnahmen sind hier verfügbar.

Unsichtbare Kämpfe? Politische Subjektivitäten im Kontext von Ost-West Migration in Europa
Viele Menschen aus dem östlichen Europa leben in westeuropäischen Kontexten. Die diesen Migrationsbewegungen zugrundeliegenden strukturellen Asymmetrien und Ungleichheiten traten besonders deutlich zutage in den Diskussionen um Arbeitsbedingungen in der Covid-19-Pandemie sowie um Geflüchtete aus der Ukraine in Folge der russischen Vollinvasion. Wir wissen jedoch zu wenig darüber, wie Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt aus dem östlichen ins westliche Europa verlagern, politisch aktiv sind und an welchen politischen Kämpfen sie sich beteiligen. Dieses Pilotprojekt erforschte verschiedene Artikulationen politischer Subjektivität in zwei wichtigen Zielländern der Ost-West Migration, Deutschland und Grossbritannien.
Das Projekt wurde durchgeführt von Aleksandra Lewicki (University of Sussex), Polina Manolova (Universität Tübingen), Kristian Shaw (University of Lincoln) und Bojana Janković (Royal Central School of Speech and Drama London).
Die Forschung wurde gefördert von einem Seed Corn Grant der British Academy in deren ‘Knowledge Frontiers Programme’ (nach der erfolgreichen Teilnahme der Beteiligten am Symposium der British Academy and der Humboldt Stiftung zum Thema ‘Mobilities’).

Kooperative Grenzschließung: Die Transnationalisierung sozialer Bewegungen gegen Einwanderung (MAM)
Ein zentrales Paradox besteht darin, dass soziale Bewegungen, deren Kernanliegen die Begrenzung der Bewegungsfreiheit ist und die sich für Isolationismus, Nationalismus und kulturellen Traditionalismus einsetzen, selbst transnational vernetzt kooperieren, etwa durch grenzüberschreitende Kampagnen und internationale Veranstaltungen. Die transnationale Dimension dieser Mobilisierung gegen Einwanderung (Mobilisation against Migration – MAM) steht in diesem Forschungsprojekt im Fokus, insbesondere in den Bereichen der (1) Interaktionen (2) Ideologien und (3) der politischen Erfolge bei der Gestaltung von Migrationspolitik. Das Projekt stützt sich auf fünf nationale Fallstudien (Deutschland, Großbritannien, Italien, Norwegen und Polen). Die britische Fallstudie ist an der University of Sussex angesiedelt. Beteiligte Forscher*innen: Dr Aleksandra Lewicki (Leitung, PI), Maddison Clark (Assistenz, RA).
Siehe hierzu auch:
‘Building a New Nation: Anti-Muslim Racism in Post-Unification Germany’
Journal of Contemporary European Studies, 28 (1) 30 – 43, 2020 (mit Yasemin Shooman)
‘Shrinking Spaces für die Zivilgesellschaft. Aktivismus unter illiberalen Vorzeichen‘
Forschungsjournal Soziale Bewegungen 33 (3) 2020 (mit Piotr Kocyba)

Diskriminierung und Rassismus im Gesundheitssektor
„Umgang mit kultureller, sozio-ökonomischer und religiöser Diversität“
Gutachten für die Stiftung Mercator (in Zusammenarbeit mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und ProDiversity)
„Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen“
Expertise für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Migrations- und Integrationsforschung, DeZIM).
Wie die Coronakrise verdeutlicht, manifestieren sich strukturelle Benachteiligungen auch in der gesundheitlichen Versorgung. Ein gutes Gesundheitssystem könnte strukturelle Ungleichheiten partiell abfedern. Jedoch sind für Menschen mit Migrationsgeschichte (bei denen sich, u.a. ethnische und religiöse Zugehörigkeit überschneiden kann) direkte und indirekte Diskriminierungen bei der gesundheitlichen Versorgung nachgewiesen. Die Forschungslandschaft in diesem Bereich ist überschaubar, jedoch gibt es punktuelle quantitative und qualitative Forschungsergebnisse in drei Handlungskomplexen: (1) beim Zugang zu Pflegeleistungen und der Nutzung von Notfallambulanzen, (2) im Bereich der Kommunikation und Interaktionen sowie (3) in den Alltagsroutinen und -abläufen.
Ansätze des Wandels sind vorwiegend reaktiv statt präventiv, und beinhalten häufiger Prozesse der interkulturellen Öffnung, als Maßnahmen des Diskriminierungsschutzes. Es gibt wegweisende Modellprojekte zur Sprachmittlung in Krankenhäusern, zum Abbau von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren in der Pflege, zur Weiterbildung von Fachkräften, sowie bei der Auswertung von Einrichtungsdaten.
Siehe dazu auch:
The material effects of Whiteness: Institutional Racism in the German Welfare State, The Sociological Review.
The Christian Politics of Identity and the Making of Race in the German Welfare State, Sociology.
Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen – Wissensstand und Forschungsbedarf für die Antidiskriminierungsforschung, Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Diskriminierungsrisiken und Handlungspotentiale im Umgang mit kultureller, sozio-ökonomischer und religiöser Diversität, Stiftung Mercator
Sind Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Covid-19 betroffen?Expertise für den Mediendienst Integration
Corona trifft Minderheiten besonders hart, Interview mit dem Mediendienst Integration
Gibt es Rassismus in deutschen Arztpraxen? Artikel von Lina Verschwele, Süddeutsche Zeitung
Was ist struktureller Rassismus? zusammengestellt von Donata Hasselmann, Mediendienst Integration

Pflegeethik und die Produktion rassialisierter und moralischer ‚Anderer‘ in öffentlichen Einrichtungen
www.bgsmcs.fu-berlin.de/en/people/
Dieses Projekt widmete sich Mechanismen der institutionellen Diskriminierung im deutschen Wohlfahrtsstaat. Der Fokus lag hierbei auf den beiden größten Anbietern wohlfahrtsstaatlicher Leistungen, der Caritas und Diakonie, sowie ihren Pflegeinrichtungen für Senioren. Beide Verbände verteidigen ihr umstrittenes Recht, vornehmlich Christen einzustellen, vor allem in Führungspositionen – gleichzeitig beschreiben sie sich als Dienstleister*innen die „offen für alle“ sind. Dieses Paradox inspirierte diese Studie; insbesondere hat mich interessiert, wie wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen dieses Bekenntnis zur Gleichbehandlung, und die darin kodierten Ausnahmen in tägliches institutionelles Handeln übersetzen. Welche institutionelle Kultur ergibt sich aus dem Prinzip der Gleichbehandlung, und der gleichzeitigen Notwendigkeit, Ausnahmeregelungen in alltägliche Entscheidungen, Routinen und Normen umzusetzen?
Siehe hierzu auch:
‚Gleichbehandlung in der Pflege? Institutionelle Diskriminierung und Reformbedarf’
in Dibelius, Olivia and Piechotta-Henze, Gudrun, Hrsg. (2020), Menschenrechtsbasierte Pflege: Plädoyer für die Achtung und Anwendung von Menschenrechten in der Pflege, 215-226, Hogrefe Verlag
‘Christliche Wohlfahrtsverbände: Vielfalt und Diskriminierung in der Seniorenpflege’
Expertise 2017 für den Mediendienst Integration
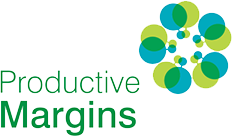
Enhancing spaces of participation
Gemeinsam mit Therese O’Toole habe ich ein partizipatives Forschungsprojekt zu glokalen Kämpfen Muslimischer Aktivistinnen durchgeführt, das sich insbesondere mit Ausschlussmechanismen in politischen Entscheidungsfindungsprozessen in Großbritannien befasst hat. Kollaborativen Ansätzen zur Prävention von politischem Extremismus kam dabei ein besonderes Augenmerk zu, da diese in Großbritannien Muslimische Frauen insbesondere in den Fokus nehmen.
Siehe hierzu auch:
‘Acts and Practices of Citizenship: Muslim Women’s Activism in the UK’
Ethnic and Racial Studies, 40 (1): 152 – 171, 2017 (mit Therese O’Toole)
‘Enhancing Spaces for Muslim Women’s Engagement’
Bristol: Policy Bristol, University of Bristol. 2015 (mit Nura Aabe, Therese O’Toole et al.) www.bris.ac.uk/media-library
‘Building the Bridge: Muslim Community Engagement in Bristol’
Research Report, Bristol: University of Bristol. 2014 (mit Therese O’Toole und Tariq Modood)
www.publicspirit.org.uk
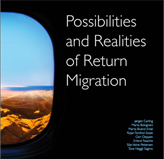
Possibilities and Realities of Return Migration (PREMIG)
Rückkehrmigration hat verschiedene Gesichter – für einige Migranten ist es ein Traum, den sie realisieren wollen, andere leben in ständiger Angst gegen ihren Willen deportiert zu werden. PREMIG basiert auf einem breiten Ansatz um diese verschiedenen Facetten von Rückkehrmigrationen zu untersuchen. Im Rahmen dieses größeren Forschungsprojekts erhob und analysierte ich eigenständig den Datensatz zu Polnischer EU Migration nach Großbritannien. Marta Bivand Erdal und ich verfassten auf dieser Grundlage eine vergleichende Analyse der Bürgerschaftspraktiken polnischer Einwanderer in Großbritannien und Norwegen, und gaben ein Sonderheft der internationalen Fachzeitschrift Social Identities heraus.
Siehe dazu auch:
‘Polish Migration to Europe: Mobility, Transnationalism and Settlement’
Special Issue Social Identities, 22 (1). 2016 (mit Marta Bivand Erdal)
‘Moving Citizens: Citizenship Practices among Polish Migrants in the UK and Norway’
Social Identities, 22 (1): 112 – 128. 2016 (mit Marta Bivand Erdal)
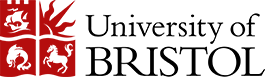
Bürgerschaft und Soziale Gerechtigkeit in der Einwanderungsgesellschaft
dbms.ilrt.bris.ac.uk/spais/people
Meine Doktorarbeit ist eine vergleichende Studie von Politiken der Gleichbehandlung und Konsultationsmechanismen mit Vertretern muslimischer Organisationen in Deutschland und Großbritannien. Meine Untersuchung zeigte auf welche strukturelle Ungleichheiten und Asymmetrien in unserem gegenwärtigen Verständnis von Bürgerschaft und Integration in der Einwanderungsgesellschaft verankert sind.
Siehe dazu auch:
‚Race, Religion and Social Justice’
in Craig Gary Hrsg. (2018)., Global Handbook of Social Justice, Cheltenham: Edward Elgar
‘The blind spots of liberal citizenship and integration policy’
Patterns of Prejudice, 51 (5) 2017.
‘Soziale Gerechtigkeit in demokratischen Bürgerschaftsdiskursen und Integrationskonzepten: Welche Konzepte von Citizenship sind gegenwärtig politikleitend?‘
in Yasemin Shooman and Dietmar Molthagen (Hrsg.) (2015), Konzepte von Citizenship und Teilhabe im europäischen Vergleich, Dokumentation der Fachtagung, 7. – 8. April, Berlin: Akademie des Jüdischen Museums und Friedrich Ebert Stiftung, www.jmberlin.de.
